25.11.2025
CCS: Der Gesetzgeber gibt mit dem neuen KSpTG endlich den Startschuss zur Kohlenstoffspeicherung in Deutschland
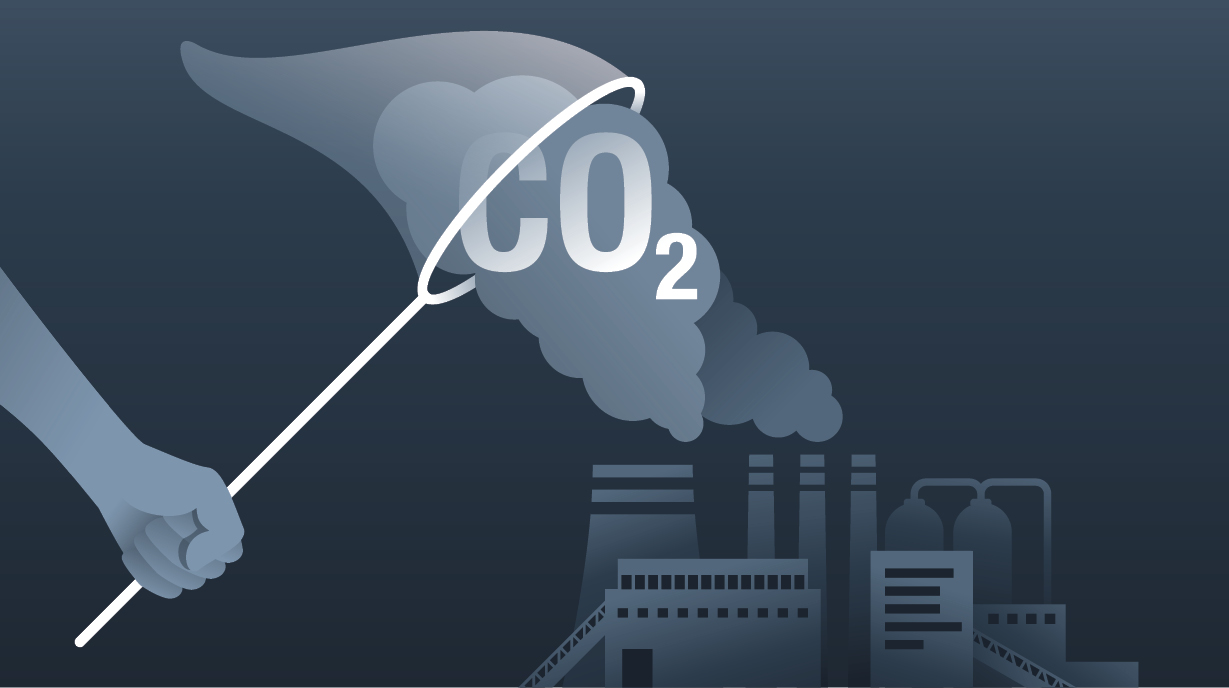
Endlich ist es da: Das Kohlenstoffdioxidspeicherungs- und -transportgesetz, kurz KSpTG, das die Grundlage für die Schaffung deutscher CO2-Speicher im kommerziellen Maßstab sowie für die Errichtung einer CO2-Transportinfrastruktur bieten soll. Für Betreiber von Anlagen mit Hard-to-abate Emissionen, Leitungsbetreiber und Investoren in CCS/CCU-Technologien bedeutet die langersehnte Verabschiedung des Gesetzes die Erreichung eines ersten Meilensteins, wenn auch noch viele Fragen offen sein dürften:
Das KSpTG knüpft an ein Vorgängergesetz (KSpG) an. Dieses erlaubte für einen befristeten Zeitraum, Kohlenstoffspeicher zunächst als Forschungsprojekte mit einer jährlichen Speicherkapazität von höchstens 1,3 Millionen Tonnen zu errichten und zu betreiben. Anträge hierauf konnten nur bis Ende 2016 gestellt werden. Speicher im industriellen Maßstab waren nicht möglich. Tatsächlich machte ein Großteil der Bundesländer von ihrer Ermächtigung Gebrauch, Forschungsspeicher in ihrem Hoheitsgebiet nicht zuzulassen. Dies hatte zur Folge, dass Deutschland neben einem Forschungsprojekt in Ketzin/Havel in Brandenburg derzeit nicht mit Forschungsspeichern trumpfen kann.
Gleiches gilt im Hinblick auf CO2-Leitungen: Obwohl das KSpG die rechtliche Basis für eine Transportinfrastruktur bot, wurde es praktisch nicht zur Grundlage von entsprechenden Infrastrukturvorhaben. Zu viele Fragen ließ es ungeklärt. Ein Knackpunkt war vor allem, dass es nur Leitungen für den Transport von CO2 zu einem Speicher, nicht aber zum Zwecke der Nutzung (CCU) erlaubte, was zu einem uneinheitlichen Regelungssystem führte. Daneben ließ das Völkerrecht mangels Ratifizierung des sogenannten London Protokolls es nicht zu, Transportleitungen zum Transport von CO2 zu den wichtigen Speicherprojekten im Ausland zu errichten bzw. in Betrieb zu nehmen. Um CCS als Klimaschutztechnologie als ernsthafte Option auf das Tableau der Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels zu bringen, trifft das neue KSpTG die folgenden neuen Regelungen:
I. Offshore
Das neue KSpTG wird erstmalig neben der Errichtung und dem Betrieb von Forschungsspeichern Speicher im kommerziellen Maßstab offshore, genauer in der ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) und auf dem Festlandsockel, erlauben. Hierbei wird es zwar Einschränkungen geben, wie z.B. die Einhaltung eines Mindestabstands zu Meeresschutzgebieten. Jedoch bietet dies völlig neue Potenziale, die Bedeutung Deutschlands in der Kohlenstoffspeicherung zu erhöhen.
II. Onshore
Weniger mutig war der Bundesgesetzgeber, was die Onshore-Speicherung angeht: Das KSpTG wird keine unmittelbare Grundlage schaffen, kommerzielle Speicher onshore zu errichten und zu betreiben. Der Bundesgesetzgeber überlässt diese Entscheidung vielmehr den Bundesländern, die über die sogenannte „Opt-In“-Klausel bestimmen können, ob sie die Onshore-Speicherung zulassen. Nur für Forschungsspeicher kommt es auf eine solche Zusage nicht an. Hier räumt der Bundesgesetzgeber den Ländern kein Mitspracherecht mehr ein, sondern räumt den Weg im gesamten Bundesgebiet für Forschungsspeicher frei. Das wiederum bietet die Möglichkeit durch erfolgreiche Pilotprojekte „vor der eigenen Haustür“ Landesgesetzgeber für die Zulassung kommerzieller Speicher zu gewinnen.
III. Und wenn die Kapazitäten nicht reichen?
Hinsichtlich der Offshore-Speicherung enthält das KSpTG neue detaillierte Regelungen für den Schutz von Meeresschutzgebieten. Vereinfacht gesagt, dürfen weder Injektionsstelle noch Einrichtungen zur Injektion oder Speicher in oder unter einem Meeresschutzgebiet liegen. Zudem ist ein Schutzabstand von 8 km zum Meeresschutzgebiet zu wahren. Das schränkt die räumlichen Möglichkeiten in der sowieso bereits stark genutzten ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) erheblich ein. Wenn diese Einschränkungen jedoch dazu führen, dass wir nicht genug Speicherkapazitäten erreichen, kann die Bundesregierung mittels Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates entscheiden, dieses detaillierte System anzugehen und z.B. Speicher unterhalb von Meeresschutzgebieten zu erlauben. Eine solche „Hintertür“ besteht für die Onshore-Speicherung hingegen nicht. Hier bleibt es bei der Opt-in Klausel der Länder, die nur durch eine förmliche Gesetzesänderung mit entsprechendem Gesetzgebungsverfahren entfallen könnte.
Weitreichender dürften die neuen Regelungen zu CO2-Transportleitungen ausfallen. So behob der Bundesgesetzgeber den Missstand, dass CO2-Leitungen, die dem KSpG unterfielen, lediglich solche waren, die CO2 zu einem Speicher transportieren. Nach den neuen Regelungen unterfallen nun auch Leitungen, die CO2 zu anderen Zwecken, wie zur Nutzung in Form des Carbon Capture and Usage (CCU) transportieren, dem Anwendungsbereich des KSpTG. Dies wiederum hat zur Folge, dass ein einheitliches Regelungsregime auf Basis der Vorschriften über das Planfeststellungsverfahren (§§ 72 ff. VwVfG) und des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) geschaffen wird, das bei Behörden und Leitungsbetreibern bekannt und ggf. bewährt sein dürfte.
Die Anwendung des EnWG, welches diverse Mechanismen zur Straffung von Planfeststellungsverfahren vorsieht, wie z.B. den Verzicht auf den Erörterungstermin in bestimmten Konstellationen, soll zudem zur Verfahrensbeschleunigung beitragen. Das neue KSpTG erleichtert außerdem den Genehmigungsprozess für Kohlendioxidleitungen auf dem Werksgelände. Wird das Werksgelände nicht überschritten, ist für die jeweilige Leitung kein Planfeststellungsverfahren durchzuführen, sofern sie einer Genehmigungspflicht nach anderen, in der Regel immissionsschutzrechtlichen Vorschriften, unterliegt.
Sowohl für Leitungen als auch für Speicher wird darüber hinaus der Rechtsweg für sämtliche Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren i.S.d. KSpTG verkürzt, indem in der ersten Instanz bereits das Oberverwaltungsgericht zuständig ist. Ob diese Maßnahmen ausreichen, entsprechende Projekte tatsächlich so schnell umzusetzen, wie die Europäische Union sich das mit ihrem Ziel einer jährlichen Injektionskapazität von 50 Mio. Tonnen CO2 bis 2030 vorstellt, ist mehr als zweifelhaft.
Erfolgreich konnte darauf hingewirkt werden, dass der Bundesgesetzgeber Projekten zur Errichtung von Kohlendioxidleitungen und -speichern das überragende öffentliche Interesse attestiert und sie offiziell als dem Klimaschutz dienend benennt. Dies schafft für Abwägungsentscheidungen, etwa im Natur- und Artenschutzrecht, eine wichtige Klarstellung. Zwar stellt der Gesetzgeber CCS-Vorhaben damit grundsätzlich auf eine Stufe mit Vorhaben zum Ausbau erneuerbarer Energien (§ 2 EEG), in der praktischen Umsetzung werden sie jedoch zurückstehen müssen: Zur Erreichung der Klimaziele nach dem KSG genießen der Ausbau erneuerbarer Energien und der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft Vorrang. CCS-Vorhaben dürfen daher insbesondere den Bau und Betrieb von Wasserstoffleitungen, Windenergieanlagen auf See sowie Offshore-Anbindungsleitungen nicht wesentlich beeinträchtigen. Für Fälle, in denen Wasserstoff- und Kohlendioxidleitungen weitgehend in derselben oder einer unmittelbar benachbarten Trasse verlaufen, wird dabei klargestellt, dass regelmäßig keine zusätzlichen Konflikte mit anderen Belangen zu erwarten sind. Neu im KSpTG finden sich neben den bereits erwähnten Neuerungen im Bereich Meeresumweltschutz weitere Klarstellungen hinsichtlich zu berücksichtigender öffentlicher Belange: So werden die Belange der Aquakultur und Fischerei gesondert herausgestellt. Ob diese Regelungen ausreichen, die komplexen Nutzungskonflikte in der AWZ zu lösen, bleibt abzuwarten.
Die Federführung bei dem Erlass von Rechtsverordnungen zur detaillierten Festlegung der Anforderungen an Errichtung, Betrieb, Überwachung, Stilllegung, Nachsorge und Beschaffenheit von Kohlendioxidspeichern wird künftig das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie übernehmen. Dessen Geschäftsbereich soll die gesamte Prozesskette von CCS und CCU abdecken. Dem ursprünglich zuständigen Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit bleibt damit künftig lediglich eine unterstützende Rolle.
Die Verordnungskompetenz soll sich zudem auf den Erlass jener Regelungen erstrecken, die zur Umsetzung der durch den Net Zero Industry Act (NZIA) begründeten Pflicht der Erdöl- und Erdgasbranche zur Schaffung von Injektionskapazitäten erforderlich sind (hierzu mehr in diesem Blogbeitrag). Insbesondere soll auf diese Weise eine Zahlungspflicht pro Tonne nicht geschaffener jährlicher Injektionskapazität eingeführt werden, um den durch die Nichterfüllung der Pflichten entstehenden Vermögensvorteil abzuschöpfen.
Ein Punkt, bei dem der Bundesgesetzgeber Wirtschaftsverbänden gefolgt ist, ist die Klärung der Zuständigkeiten für den Vollzug des KSpTG im Offshore-Bereich. So war zuvor unklar, ob das Bundesamt für Schifffahrt und Hydrographie (BSH), das sich um die Raumordnung in der AWZ kümmert, auch für Vorhaben in der AWZ zuständig werden könnte. Das neue KSpTG stellt nunmehr jedoch klar, dass zur Abgrenzung der Zuständigkeiten in der AWZ das sogenannte Äquidistanzprinzip gilt. Grenzlinie ist danach die mittlere Linie durch alle Punkte, welche gleich weit entfernt (äquidistant) von den nächstgelegenen Punkten der sogenannten Basislinien sind, von denen wiederum aus die Breite des Küstenmeeres der Länder Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gemessen wird. Im Bergrecht, auf das das KSpTG insoweit verweist, führt dies bisher zur Zuständigkeit des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie bzw. des Bergamts Stralsund. Daneben wird man sich aber nach wie vor als Projektträger mit zahlreichen weiteren Behörden, wie dem BSH, der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt und der Deutschen Emissionshandelsstelle, sowie diversen weiteren Playern, vor allem Vertretern von Umweltbelangen, Fischerei, Militär und Schifffahrt auseinandersetzen müssen. Hier ist gutes (juristisches) Projektmanagement gefragt. Dies dürfte auch für Onshore-Projekte gelten.
Gleichzeitig legte die Bundesregierung den ersten wichtigen Baustein hin zur Beteiligung von Deutschland an einem europaweiten CO2-Infrastrukturnetz, indem sie dem Bundesrat einen Gesetzesentwurf zur Ratifizierung des Artikel 6 des sogenannten London Protokolls zuleitete. Das London Protokoll ist ein internationales Übereinkommen über die Verhütung der Meeresverschmutzung durch das Einbringen von Abfällen und anderen Stoffen. Sein Artikel 6 erlaubt ausnahmsweise den Export von Kohlendioxid und dessen Speicherung unter dem Meeresboden außerhalb des staatlichen Hoheitsgebiets. Damit diese Ausnahme jedoch in Kraft tritt, muss ein Drittel der Vertragsstaaten die Ausnahmeregelung ratifizieren. Sobald auch der Ratifizierungsprozess in Deutschland abgeschlossen ist, haben allerdings erst 13 von 56 der Vertragsstaaten eine entsprechende Ratifizierung vorgenommen. Um dennoch den Weg für Leitungen freizumachen, die etwa nach Norwegen oder Großbritannien führen, soll die Ausnahmeregelung vorläufig angewendet werden. Hierzu ist eine entsprechende Erklärung vor der International Maritime Organization (IMO) sowie der Abschluss von bilateralen Abkommen mit den jeweiligen Export- und Ankunftsländern erforderlich.
Im engen Zusammenhang mit dem London Protokoll steht das Hohe-See-Einbringungsgesetz. Dieses steht derzeit noch der Einbringung von Kohlenstoff ins Meer entgegen, weshalb es entsprechend geändert werden soll. Zu diesem und zur Umsetzung des London Protokolls wurde am 21. November 2025 im Bundesrat beraten.
Das KSpTG setzt den ersten wichtigen Grundstein für eine CO2-Infrastruktur, die unentbehrlich für den Klimaschutz ist. Es ist auch Stein des Anstoßes, um Förderungen für entsprechende Vorhaben vorsehen zu können. Jetzt sind vor allem die Landesgesetzgeber gefragt, den Weg frei für entsprechende Onshore-Projekte zu machen. Doch auch der Bundesgesetzgeber und die neue Bundesregierung sollten sich nicht allzu bequem zurücklehnen. Denn die Praxis wird sehr zügig das KSpTG auf die Probe stellen. Wie bei jeder anderen neuen Technologie sind auch hier noch einige Fragen offen, wie etwa die Umsetzung der Beteiligung von Kohlenstoffleitungen und -speichern am Europäischen Emissionshandel oder zur Qualität des transportierten und gespeicherten CO2. Hier wird Engagement auf Europäischer Ebene erforderlich werden, um auf praxistaugliche Lösungen hinzuwirken.

Pauline Müller
Senior Associate
Düsseldorf
pauline.mueller@luther-lawfirm.com
+49 211 5660 14080